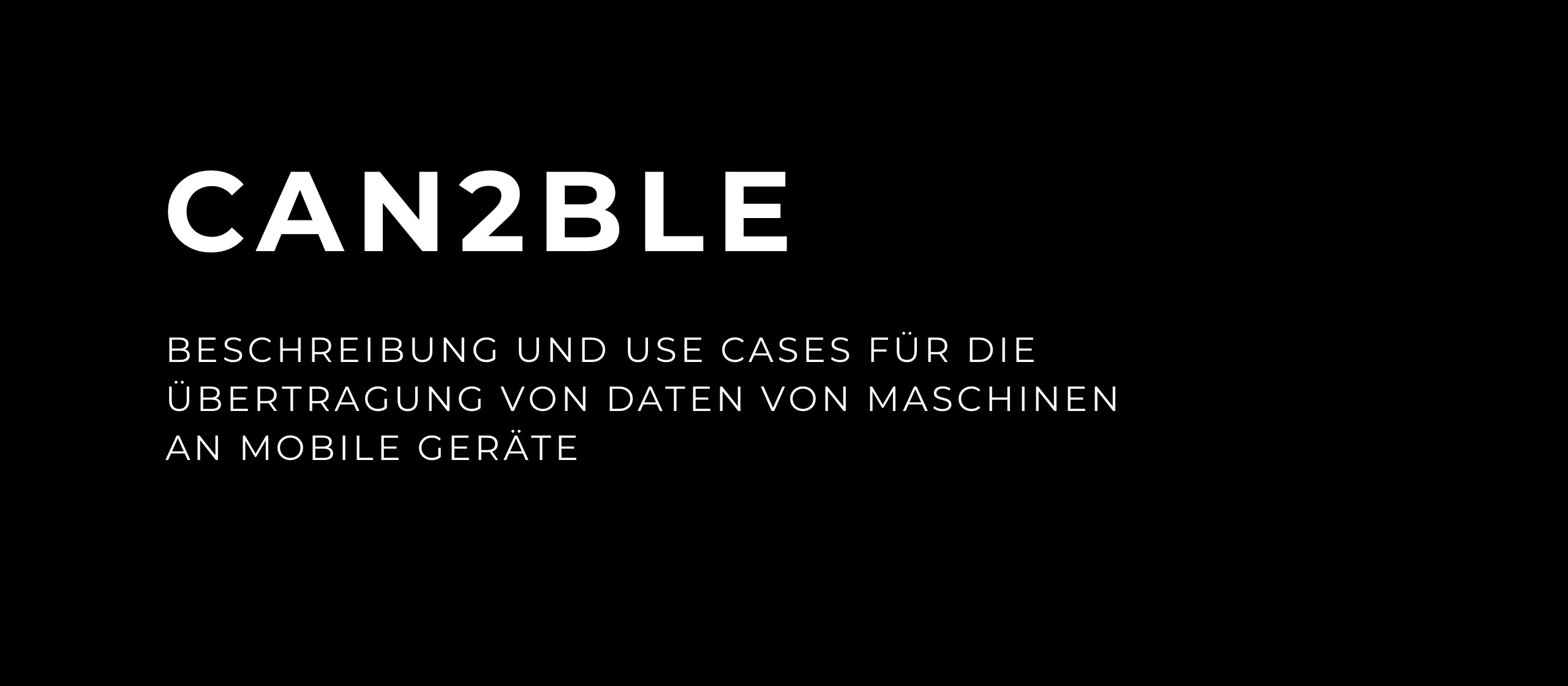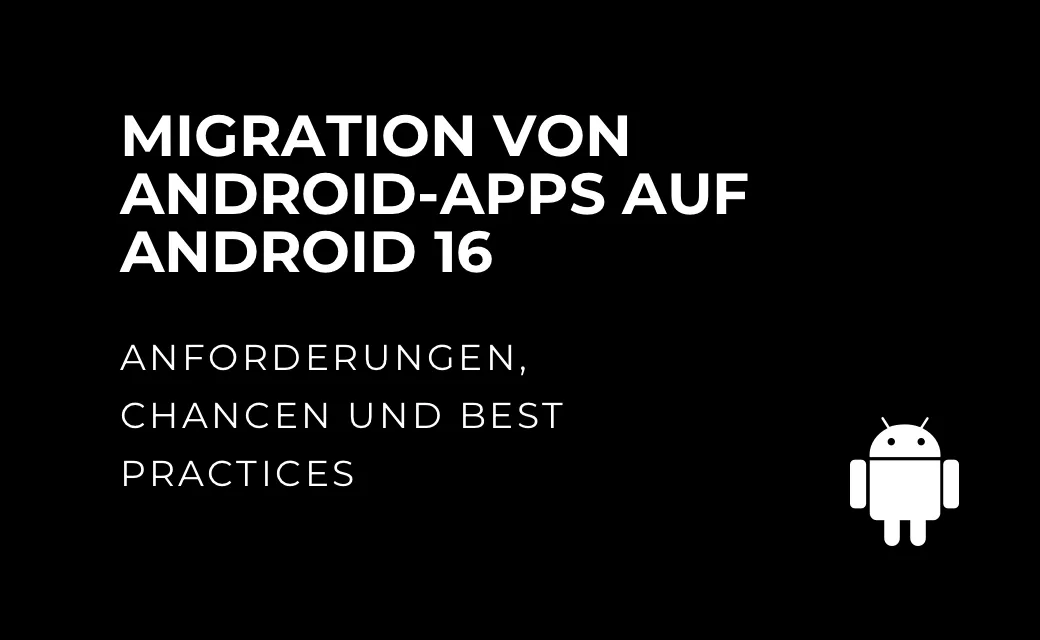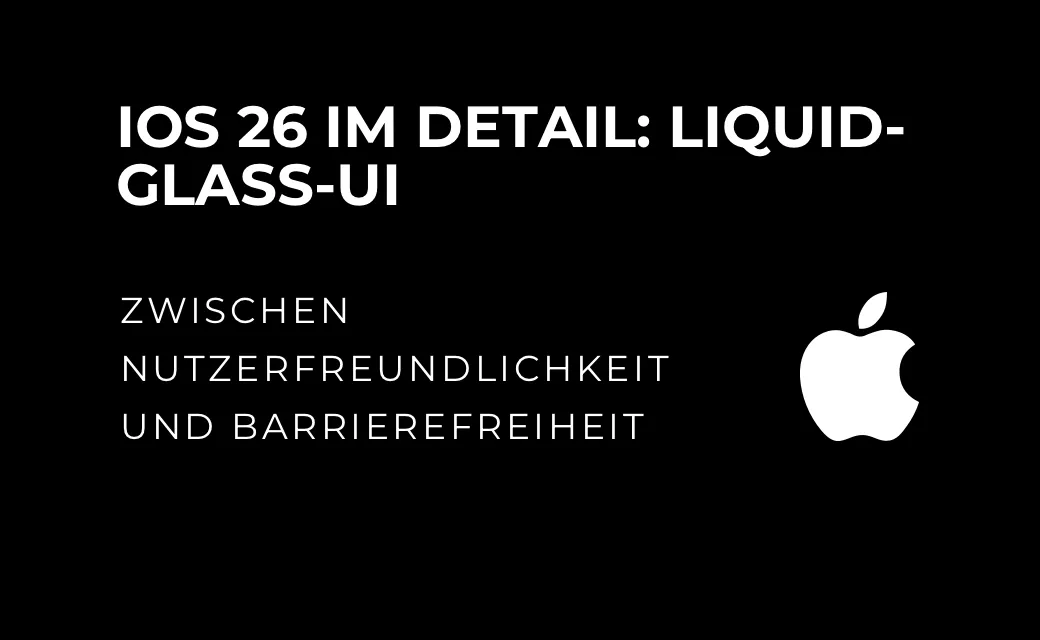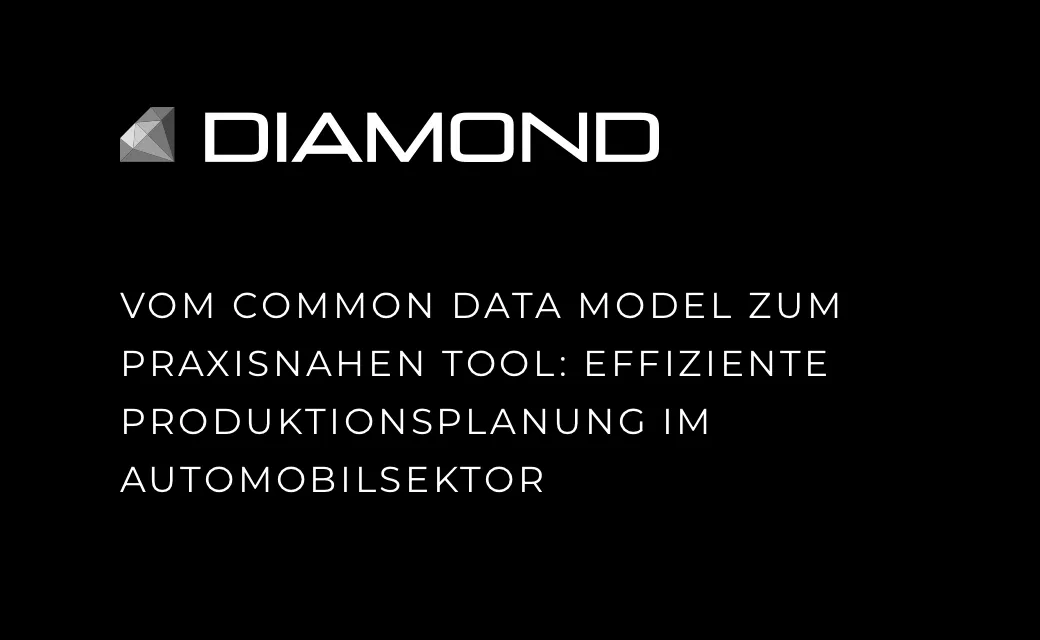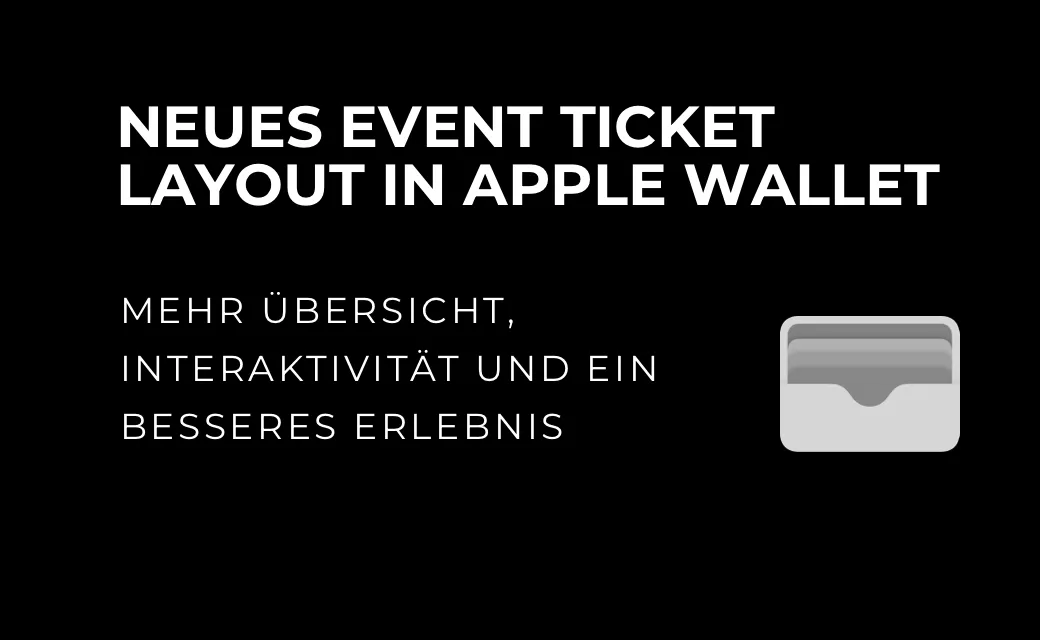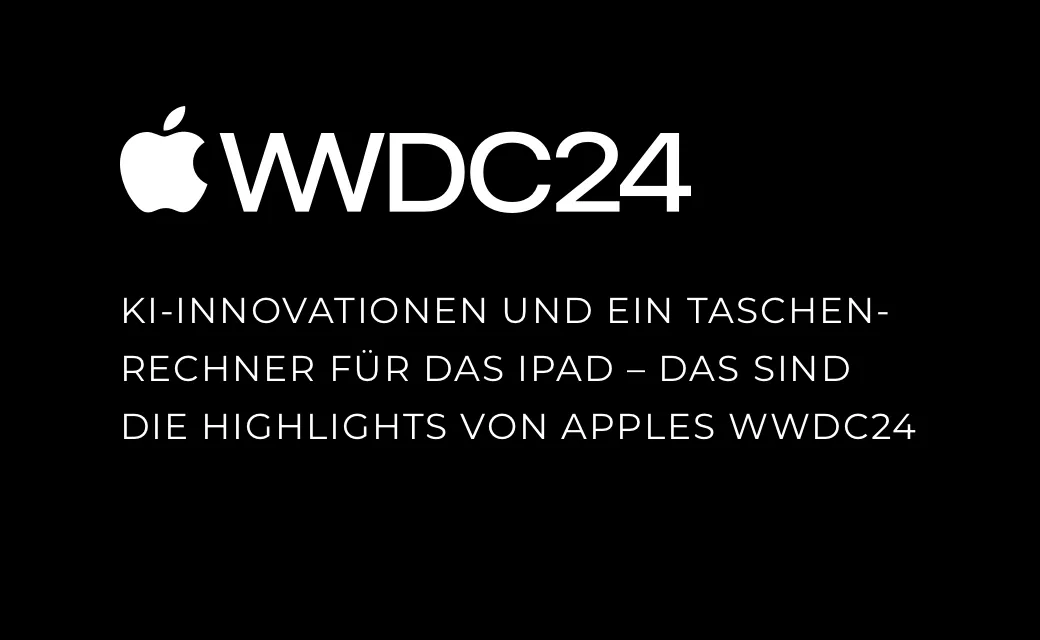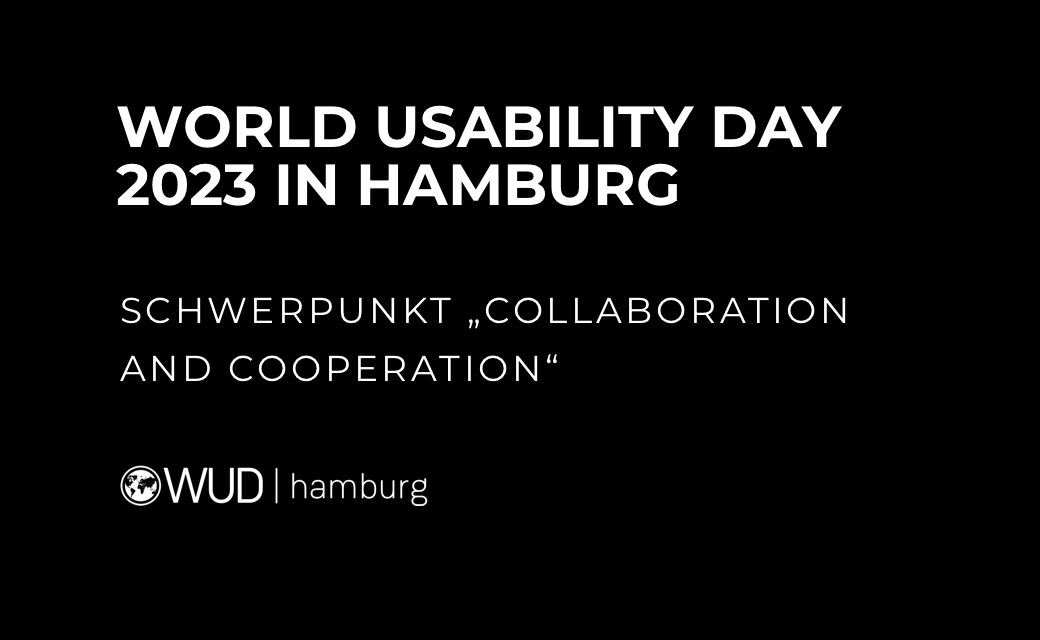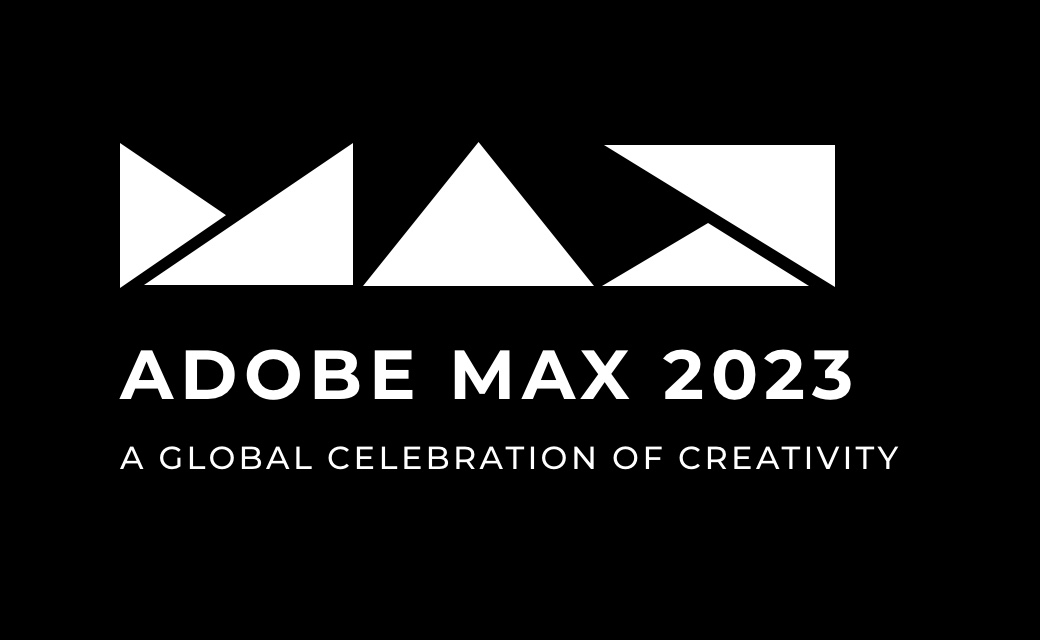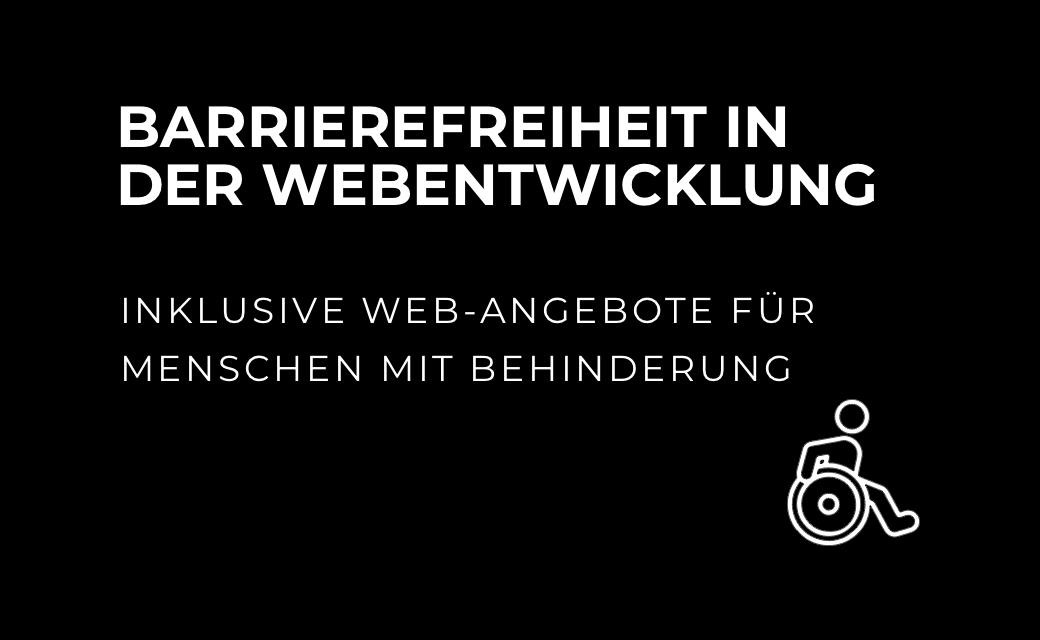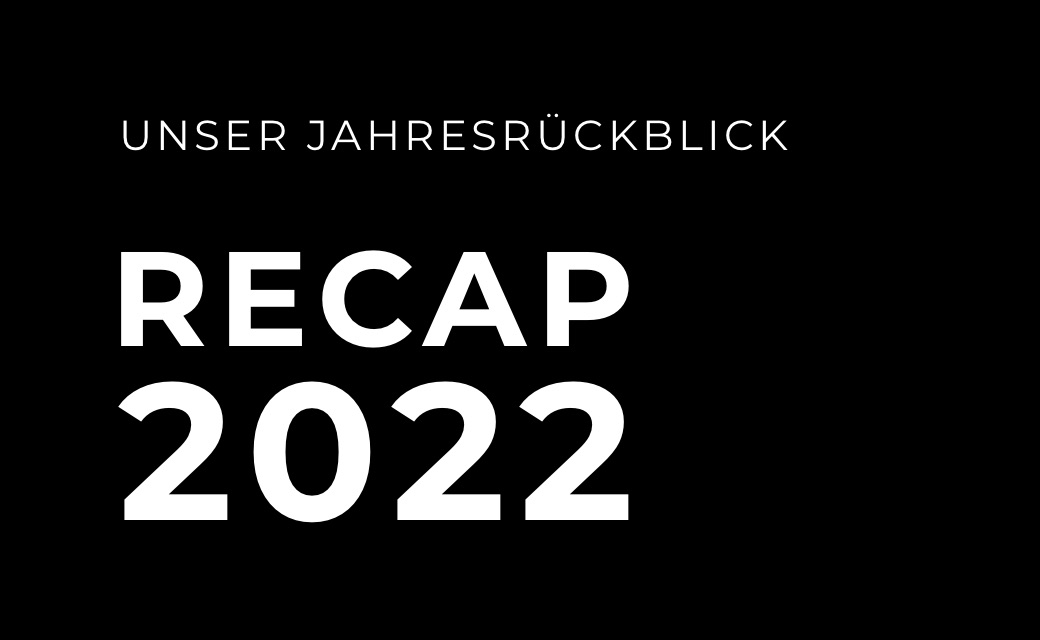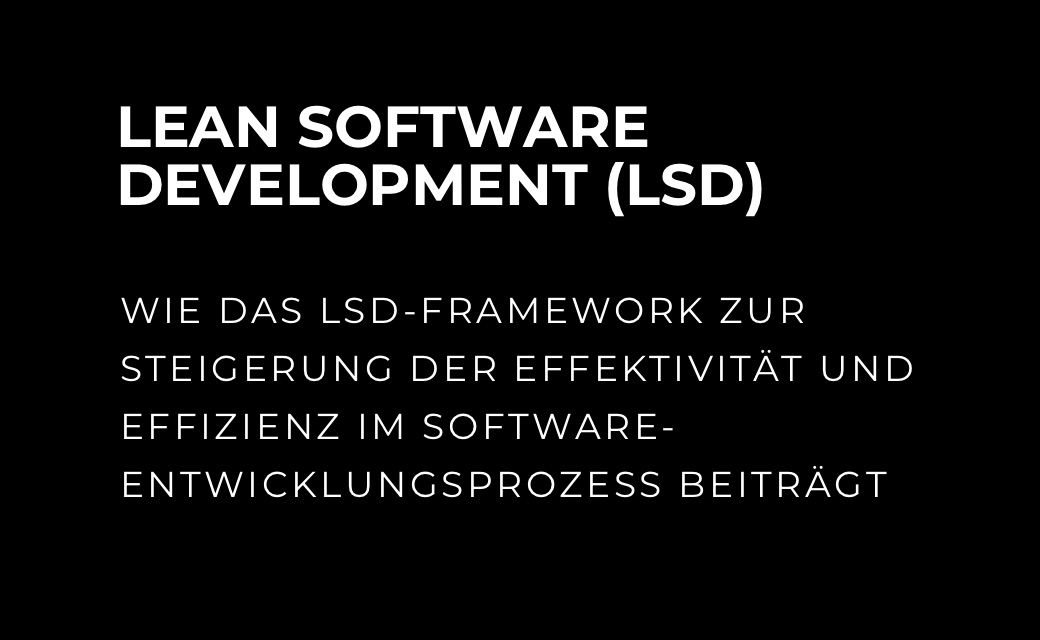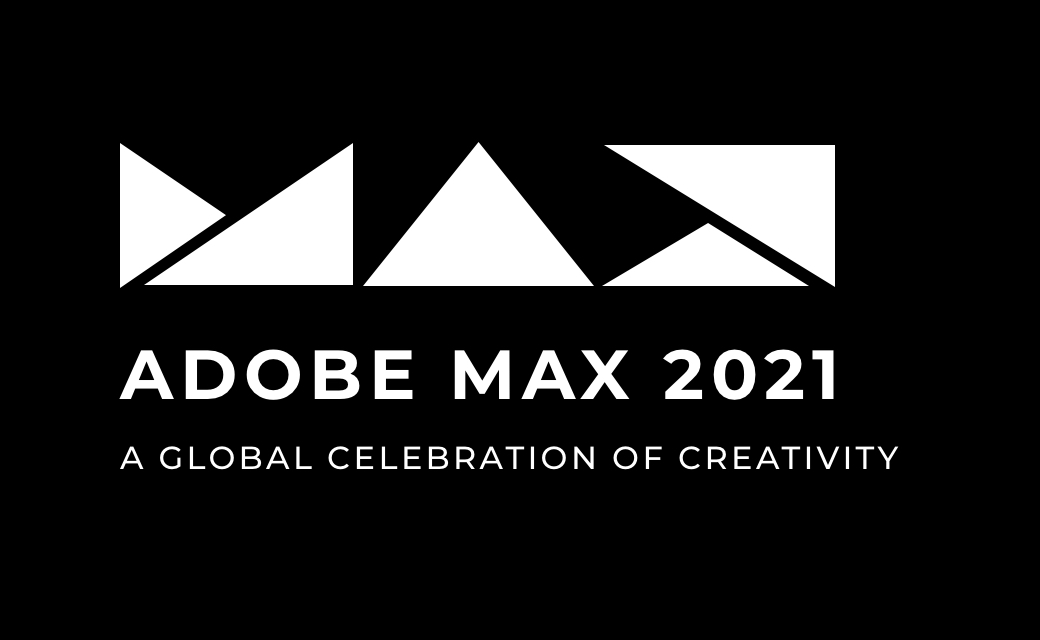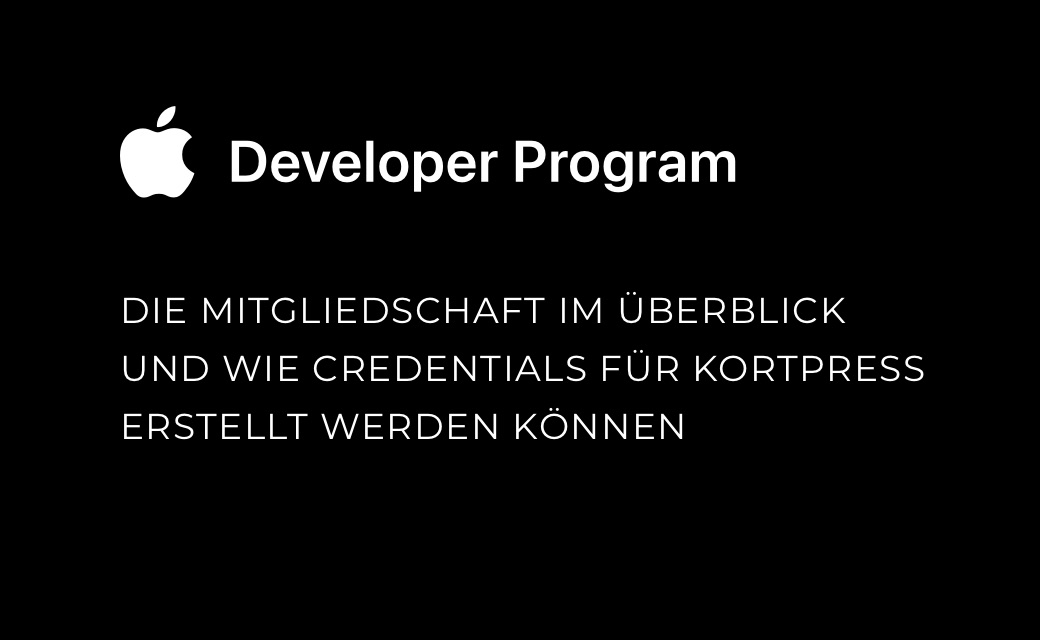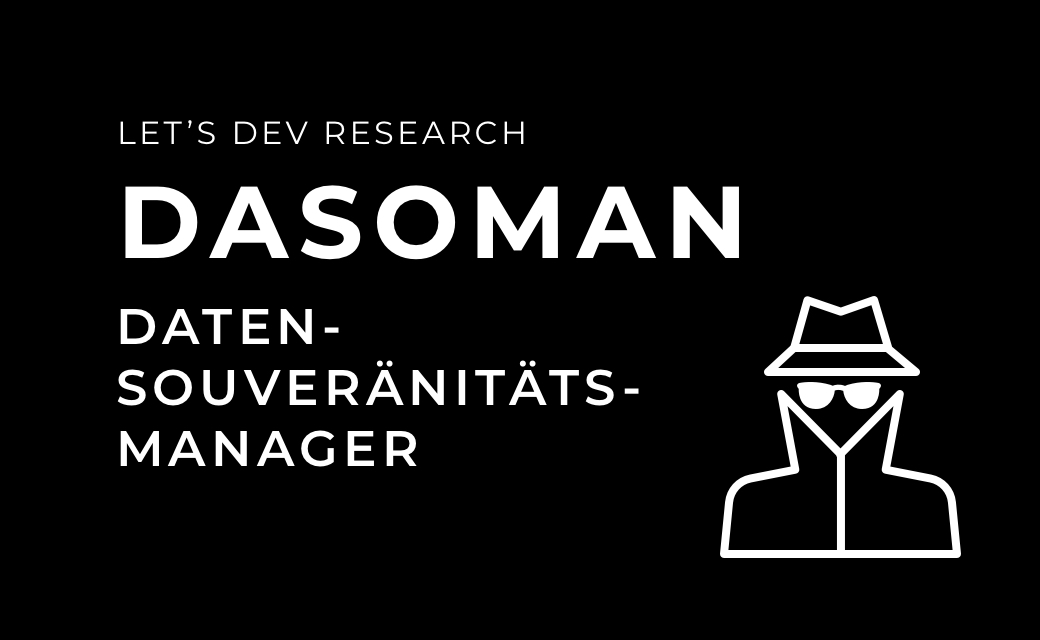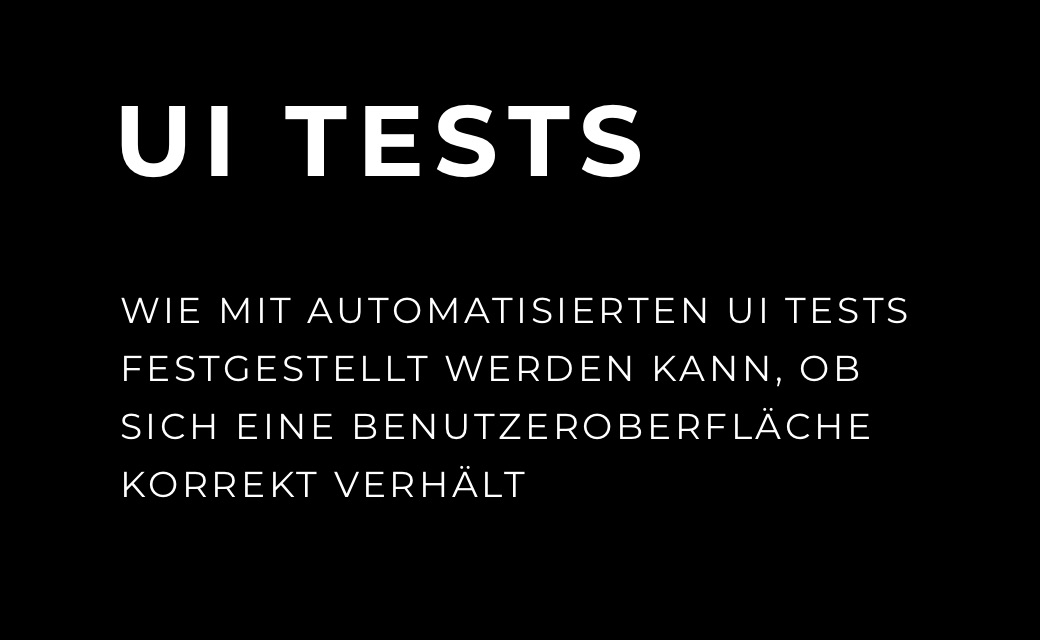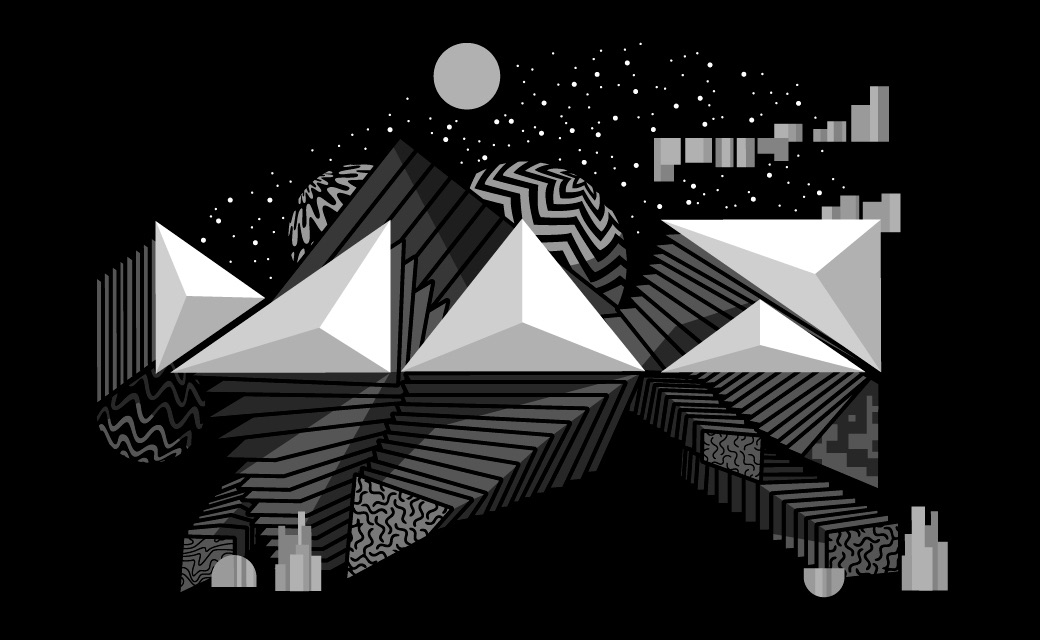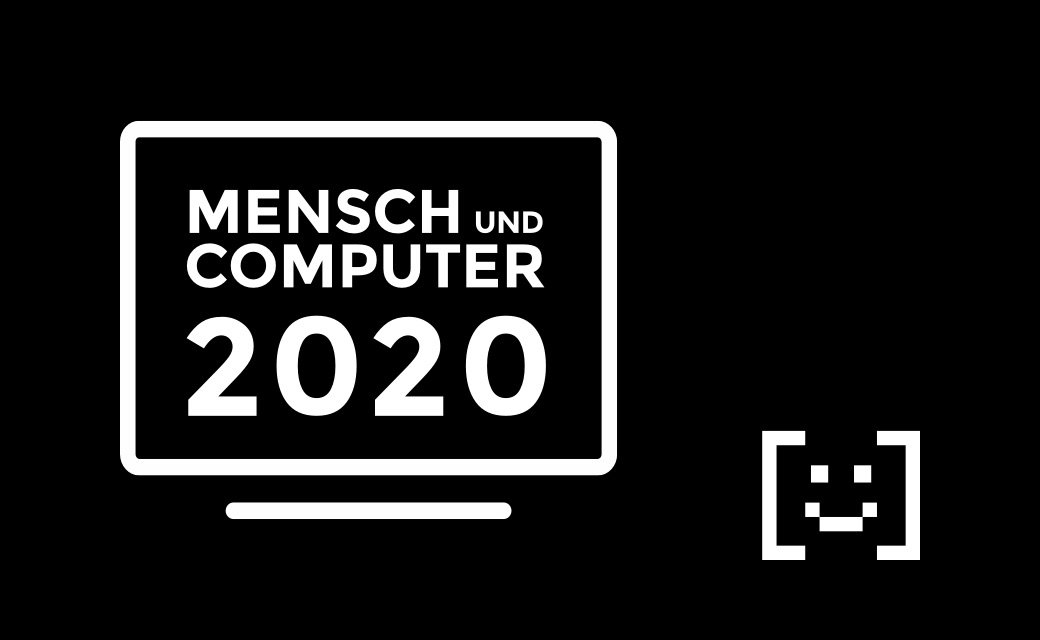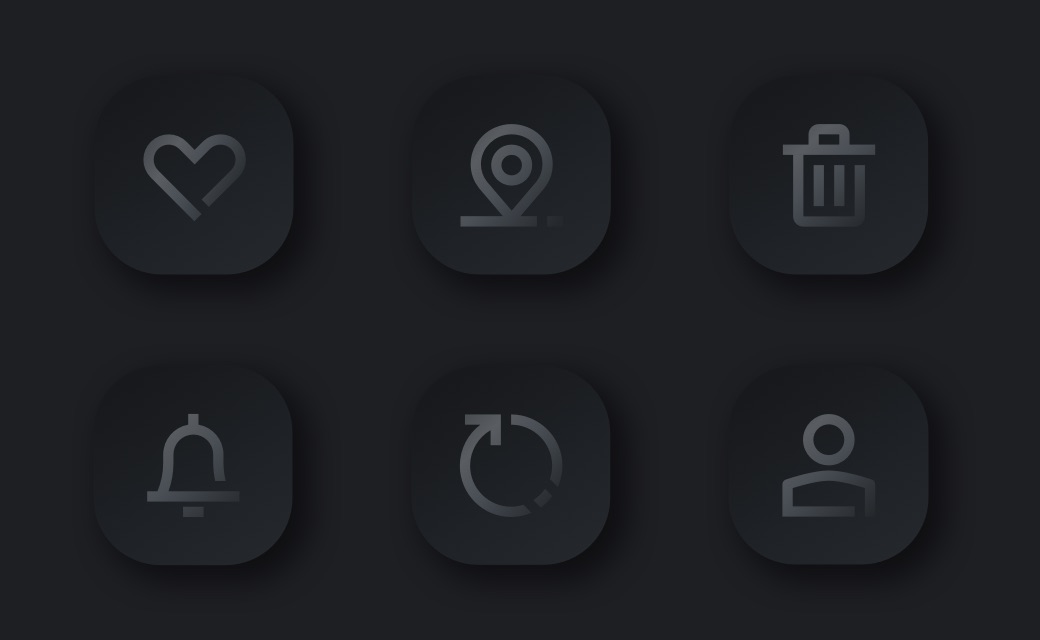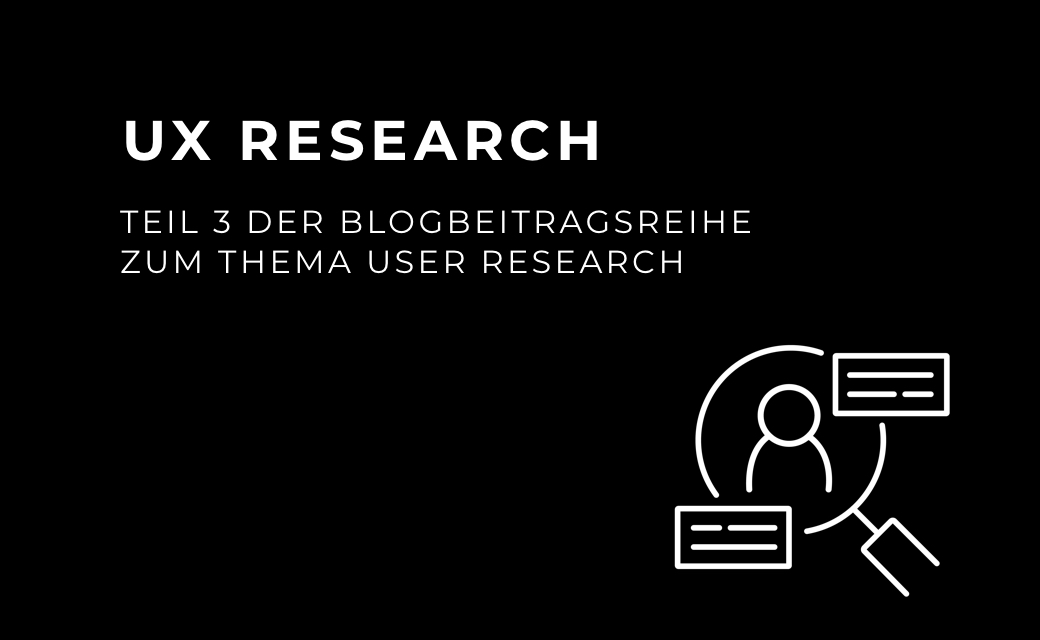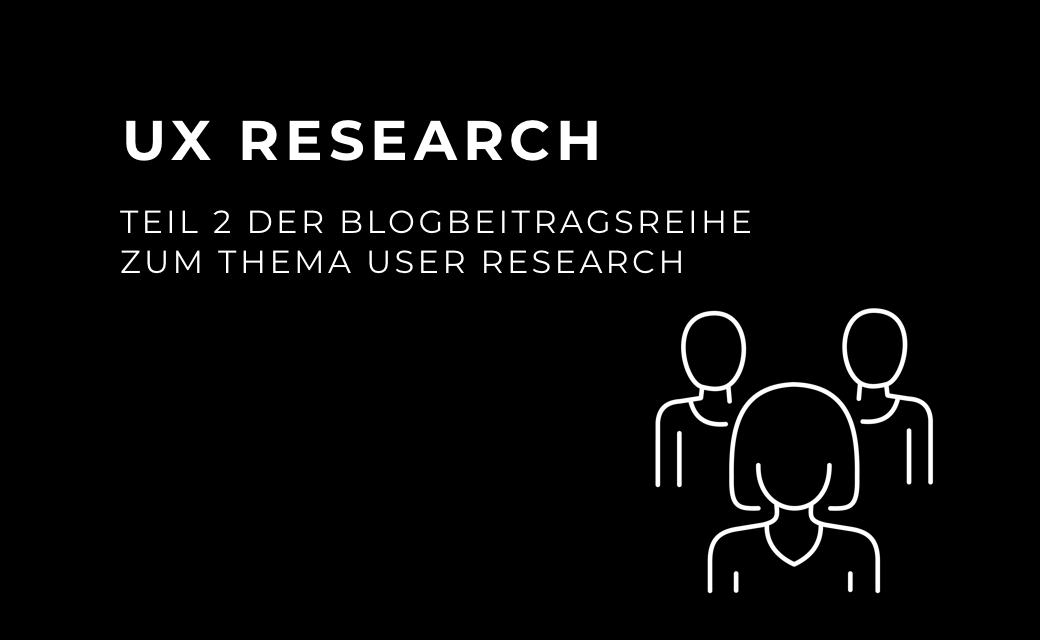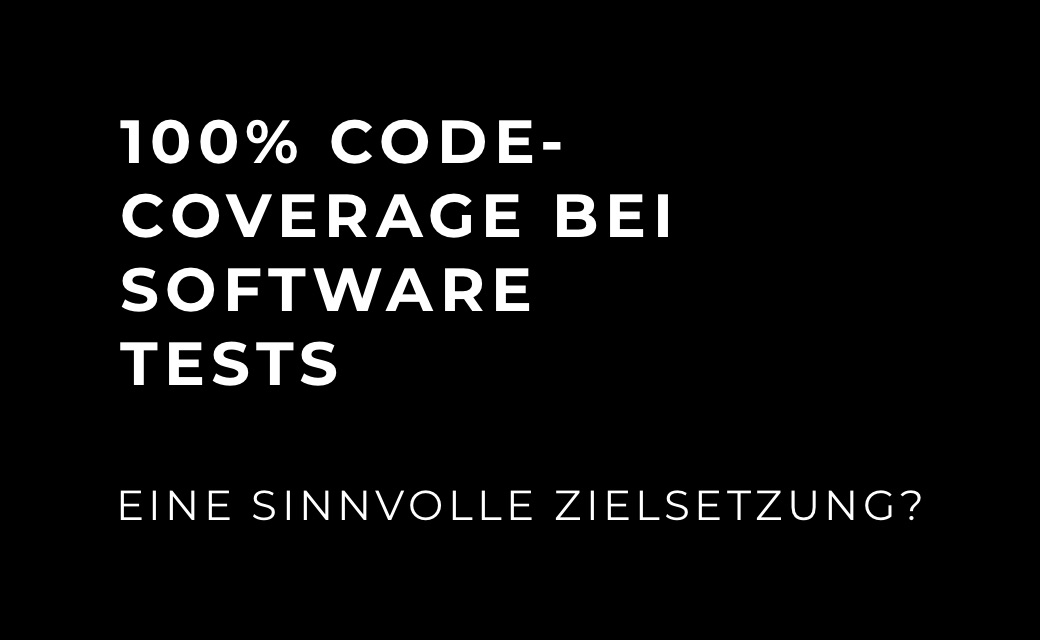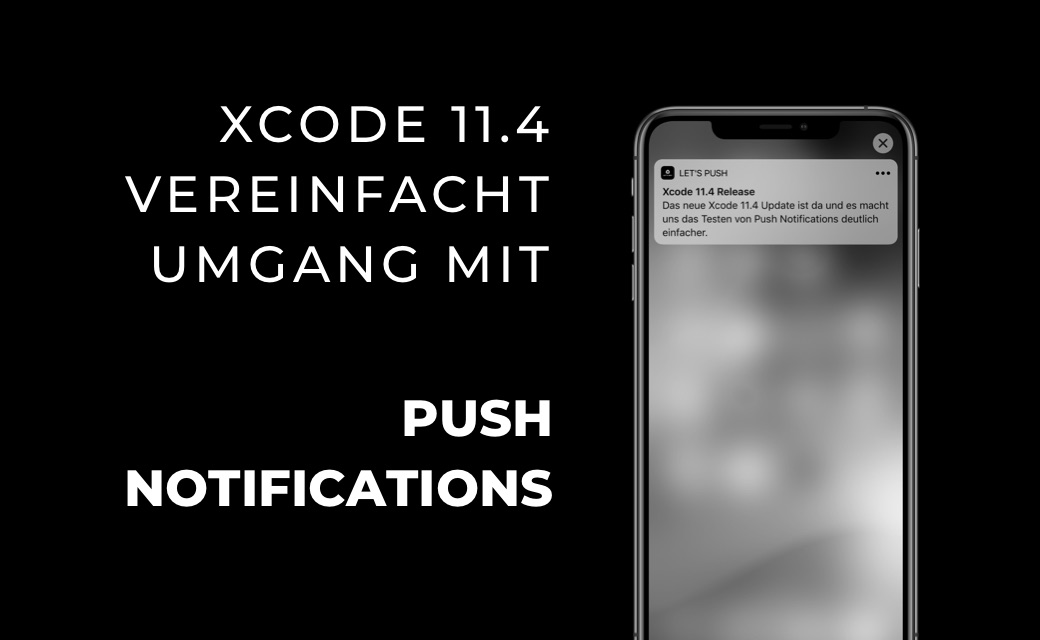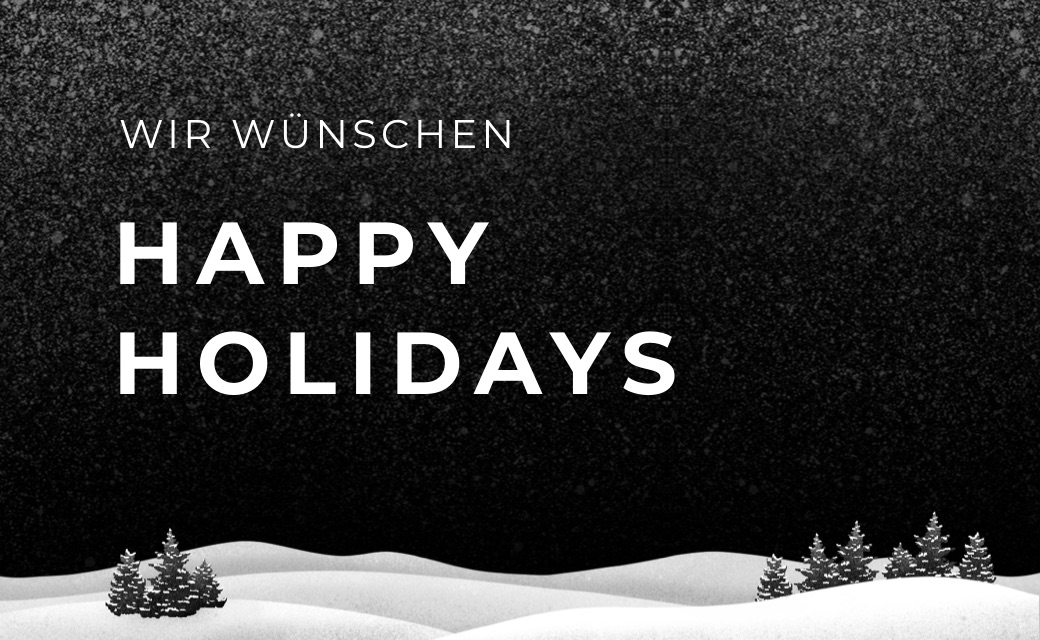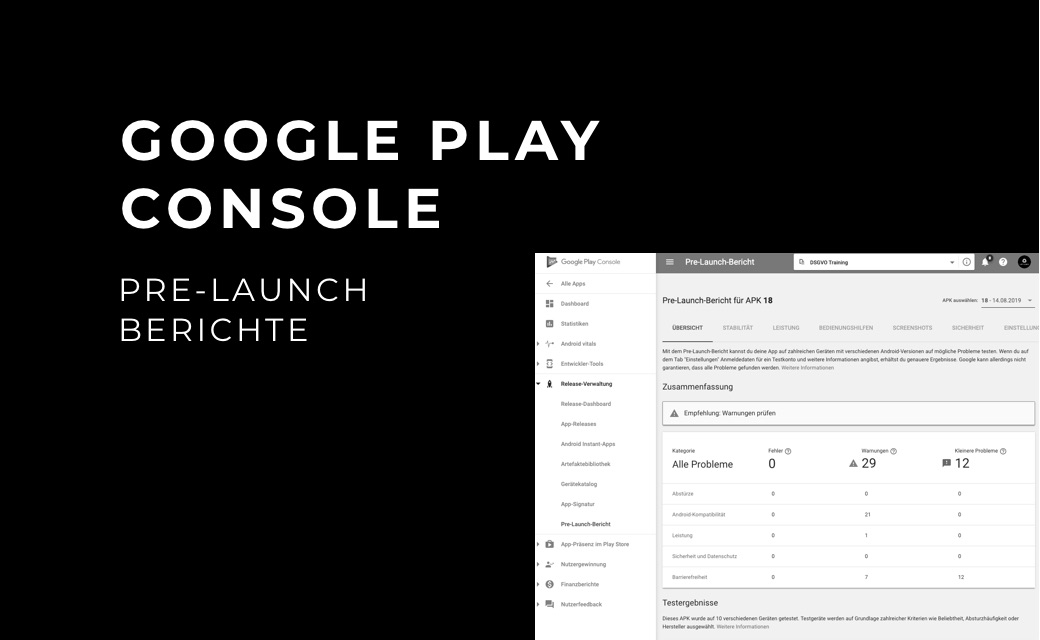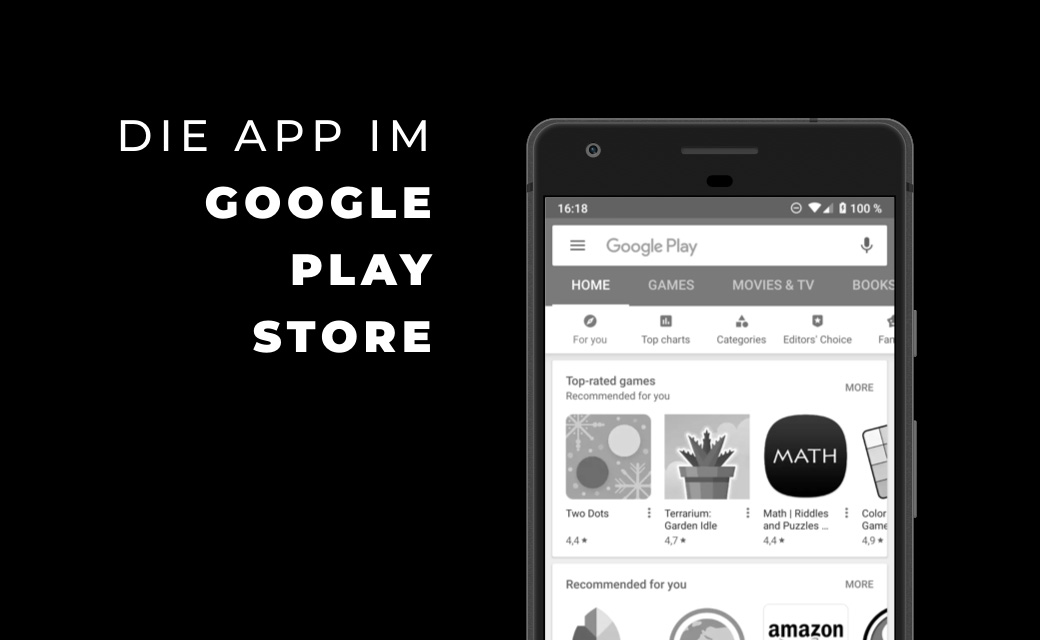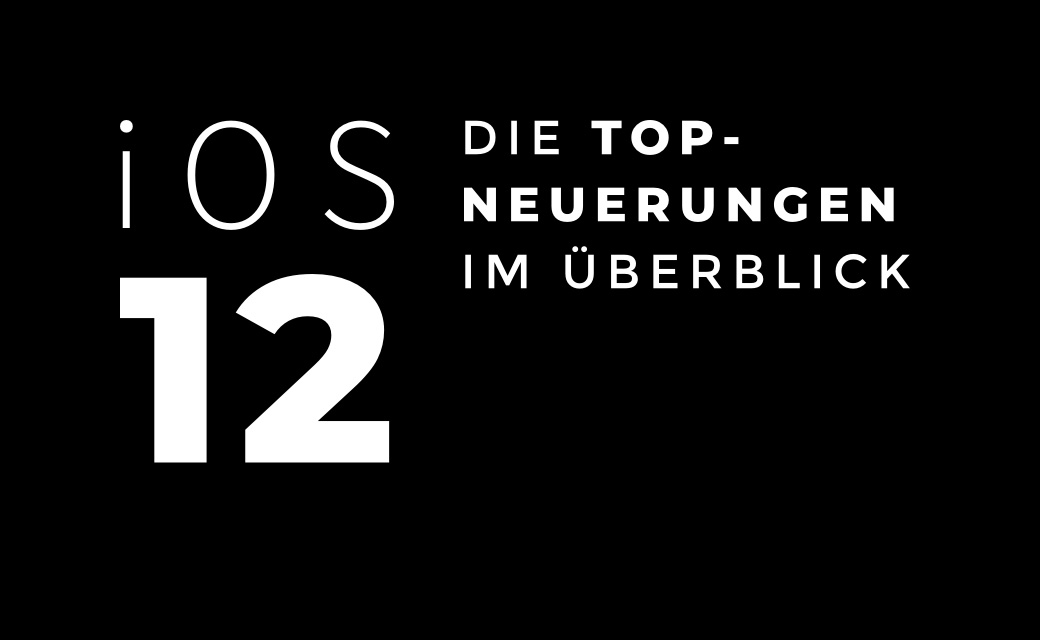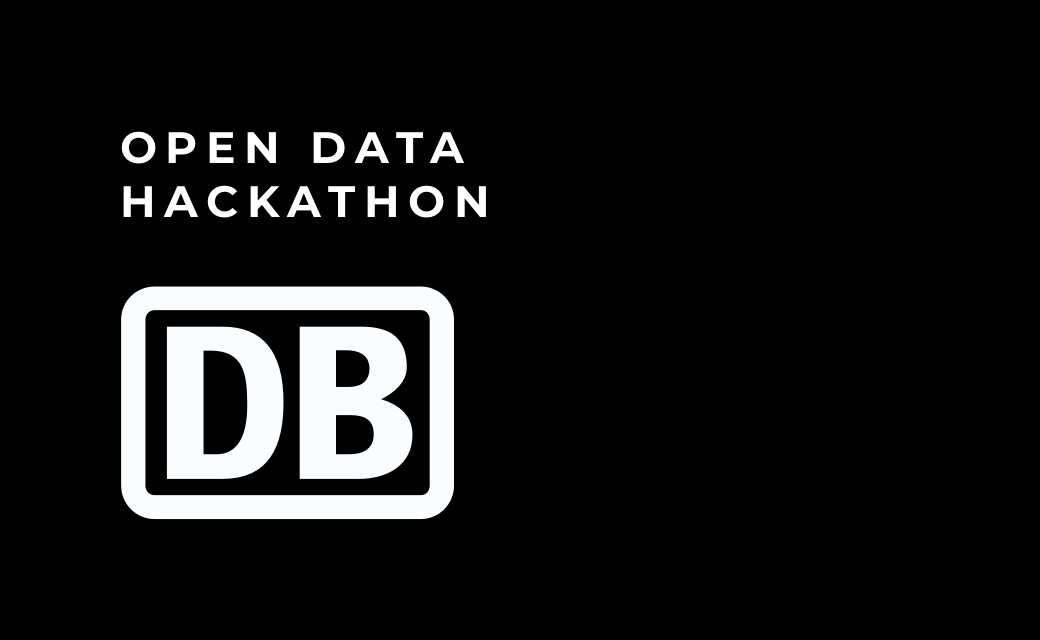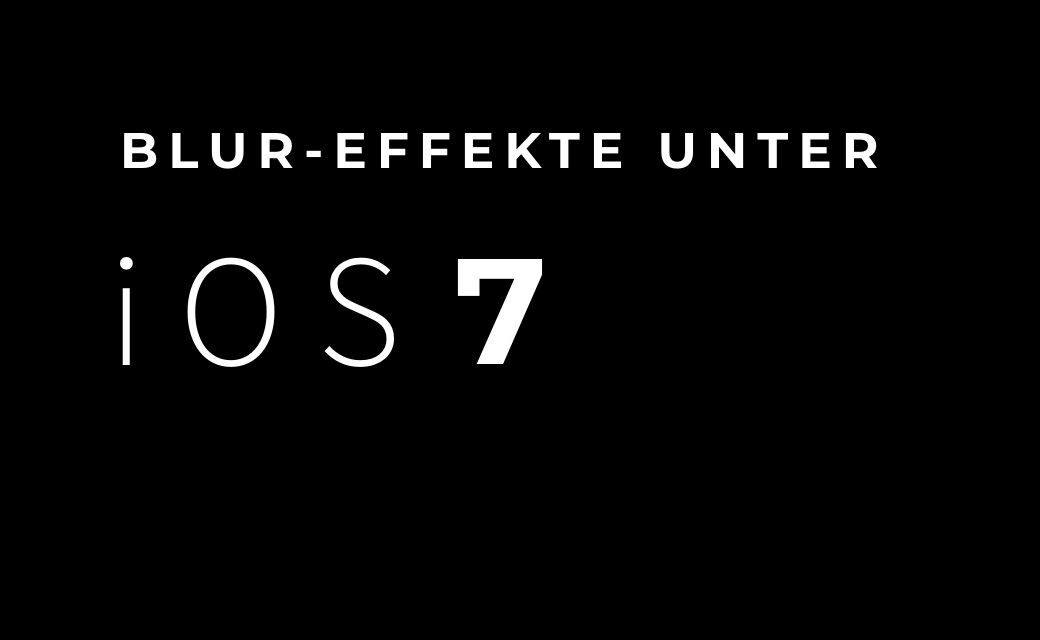CAN
Das Controller Area Network (CAN) ist eines der gängigsten Bus-Protokolle in der
Kraftfahrzeugindustrie. Es wurde 1986 von Bosch
vorgestellt. Der Hauptantrieb für die Entwicklung war die Reduzierung von Kabeln in
Kraftfahrzeugen und die damit verbundene
Kostensenkung bei der Herstellung. Seit 1993 wird CAN in der ISO 11898 standardisiert
und regelmäßig an die neuen technischen
Gegebenheiten angepasst. Die CiA (CAN in Automation) kümmert sich um die
Weiterentwicklung des CAN-Standards. Heute verwenden
viele Kraftfahrzeuge und Industriegeräte den CAN-Standard.
Das CAN-Protokoll definiert die Datenübertragung auf der Bitübertragungsschicht und der
Sicherungsschicht des OSI 7
Schichten-Modells. Im Folgenden soll ein grober Überblick über die Funktion von CAN
gegeben werden.
Da CAN hauptsächlich dafür verwendet wird, mehrere elektronische Steuereinheiten zu
verbinden, die alle Daten senden und
empfangen müssen, wird eine Multi-Master-Bus Architektur verwendet.
Das bedeutet, dass alle Knoten (z. B. eine Steuereinheit) auf dem Bus lesen und
schreiben können. Um Kollisionen aufzulösen, die
durch den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Knoten auf den Bus entstehen können, wird das
CSMA/CR Verfahren verwendet. Es sorgt
dafür, dass nur der Knoten mit der höchsten Nachrichtenpriorität auf den Bus
zugreift.
Eine CAN-Nachricht, auch Frame genannt, besteht aus sieben Feldern:
- Das Startfeld (1 Bit): Markiert den Start eines Frames.
- Das Arbitrierungsfeld (12 Bits): Setzt sich aus dem Message Identifier (11 Bits) und
dem Bit zur Unterscheidung zwischen
Data oder Remote Frame zusammen.
- Das Steuerfeld (6 Bits): Setzt sich aus den 4 Bits, welche die Länge des folgenden
Datenfelds angeben und zwei, für
Erweiterungen reservierten Bits zusammen.
- Das Datenfeld (0-64Bits): Enthält die eigentlichen Daten der CAN-Nachricht.
- Das Datensicherungsfeld (16 Bits): Enthält die CRC-Prüfsequenz(15 Bits) und ein
Begrenzungsbit.
- Das Endefeld (7 Bits): Markiert das Ende eines Frames.

BLE
Bluetooth Low Energy (BLE), ist ein ursprünglich von Nokia entwickelter Bluetooth
Standard, welcher den hohen Stromverbrauch
herkömmlicher Bluetooth Module reduzieren sollte. Hierfür werden in größeren Abständen
geringere Datenmengen ausgetauscht. BLE
ist Teil der Bluetooth 4.0 Spezifikation von 2010. Inzwischen hat sich der Standard
durchgesetzt und viele Smartphones sowie
andere Geräte, wie z. B. Fitnesstracker verwenden BLE zur Datenübertragung.
Im BLE-Standard können Geräte verschiedene Rollen annehmen. In unserem Anwendungsfall
würde es ein Gerät geben, welches die
Peripheral Rolle einnimmt und Connectable Advertiser Events schickt, welche ein anderes
Gerät dafür nutzen kann, um sich mit dem
Gerät zu verbinden und die Datenübertragung zu starten.
CAN2BLE
Um CAN-Nachrichten über BLE zu übertragen ist eine Hardware Schnittstelle notwendig,
welche entweder fest in ein Gerät verbaut
wird oder an einen freien CAN-Stecker gesteckt werden kann. Diese Schnittstelle würde
die Peripheral Rolle einnehmen. Je nach
Konfiguration kann die Schnittstelle auf Wunsch eine Connection anbieten. Ein anderes
Gerät kann sich nun mit der Schnittstelle
verbinden und Daten können übertragen werden.
Hierbei sind zwei weitere Dinge zu beachten:
- In den meisten Fällen sollte die Schnittstelle die Daten für die Übertragung mit BLE
aufbereiten.
- Da mittels BLE over the air Übertragung stattfindet, sollten Daten vor der
Übertragung verschlüsselt werden.
Die Aufbereitung der Daten kann vielfältig aussehen. Da viele Informationen im Frame
einer CAN-Nachricht für die Verarbeitung
uninteressant sind, macht es Sinn, die Daten aus dem Datenfeld in ein eigenes Protokoll
zu verpacken und damit zu senden. Sollte
Verschlüsselung nötig sein, muss die Schnittstelle diese ebenfalls implementieren.
Anwendungsfälle
Im folgenden sollen zwei hypothetische Anwendungsfälle für die beschriebene Technologie
vorgestellt werden.
1.) CAN2BLE in einer Fertigungsmaschine für Wartungsdaten
In unserem konkreten Fall möchte ein Unternehmen seinen Wartungsprozess verbessern.
Bisher musste ein Mitarbeiter mit einem dedizierten CAN-Diagnose-Gerät zu jeder Maschine
gehen, ein Kabel einstecken und die
Daten auslesen. Anschließend entscheidet er, ob die Maschine nachjustiert oder
anderweitig gewartet werden muss.
Alternativ könnten die Maschinen mit einem CAN2BLE Modul ausgerüstet werden. Statt eines
dedizierten Gerätes könnte der
Mitarbeiter ein Smartphone verwenden mit dem schon andere Prozesse des Unternehmens
optimiert wurden. Nun verbindet er sich über
BLE mit einer Maschine und erhält die Daten auf seinem Smartphone. Je nach Wunsch kann
hier eine App entwickelt werden, welche
die Daten anzeigt, auswertet, visualisiert und an ein zentrales System schickt. Die
Entscheidung für die Wartung könnte direkt
vom System getroffen werden, z. B. wenn gewisse Werte über der akzeptablen Grenze
liegen.
2.) CAN2BLE in einem Bagger zur Arbeitsdokumentation und Performance
Evaluation
In unserem konkreten Fall will ein Baggerhersteller seinem Kunden einen Mehrwert für
ihre Bagger bieten und die Daten, die von
den internen Systemen des Baggers erhoben werden, nutzen.
Hierfür baut er ein CAN2BLE
Modul in seine neuen Bagger ein und rüstet
alte Bagger nach. Zusätzlich lässt er eine Applikation entwickeln, welche, wenn sich das
Smartphone mit der Schnittstelle des
Baggers verbindet, erlaubt, die Daten (z. B. Gewicht auf der Schaufel) während eines
Arbeitsschritts zu tracken. Die App bietet
dem Baggerführer während der Arbeit eine visuelle Aufbereitung der Daten. Nach der
Arbeit bietet die App dem Baggerführer die
Möglichkeit, sich die kompletten Daten aufbereitet nochmals anzusehen, um zu überprüfen,
ob alle Werte in Ordnung sind.
Zusätzlich bietet ihm die App an, einen Bericht mit den Daten zu erstellen und zu
verschicken. So kann ein Bauunternehmen,
welches mehrere Maschinen besitzt, alle Daten zentral sammeln. Außerdem kann so auch
überprüft werden, ob Arbeiten ordnungsgemäß
ausgeführt wurden. Ein weiterer Mehrwert kann das Sammeln der Daten für eine Maschine
sein, um ihre Leistung zu messen und so
festzustellen, ob eine Wartung nötig ist.
In der Zukunft könnte man sich vorstellen, dass durch das Auslesen von Daten von allen
Maschinen auf einer Baustelle genau
getrackt werden kann, wie, wo und wann was gemacht wurde, um eine bessere Planung und
effizienteres Arbeiten zu ermöglichen.
Außerdem wäre theoretisch auch eine Kommunikation zwischen den Geräten über die
Smartphones denkbar, um Prozesse weiter zu
optimieren, dokumentieren oder zu automatisieren.